
ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
1
Google AdWords: Bundesgerichtshof stärkt Rechte der Markeninhaber
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford) | SEITE 04
Steuerklauseln im KG Vertrag überprüfen
StB Dr. Volker Streu, RA Dr. Sebastian Garbe | SEITE 10
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz ist in Kraft getreten
WPin StBin Beatrix Arlitt, StBin Britta Zelder | SEITE 14
compact
Aktuelle Informationen für Mandanten · Ausgabe III · 2015
RECHT AKTUELL
04 Google AdWords: Bundesgerichtshof stärkt Rechte der
Markeninhaber
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)
05 Gesetz zur „Frauenquote“ in Kraft getreten
RA Dr. Hans Mewes
06 Bundesgerichtshof zur mittelbaren Patentverletzung
durch Lieferung aus dem Ausland
RA John Sebastian Chudziak, LL.M., RAin Anke Wilhelm, LL.M.
07 Erzeugung von Ersatzbrennstoffen: kein Anspruch auf
Begrenzung der EEG-Umlage
RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M.
RECHT AKTUELL – INTERNATIONAL
08 Dispute Resolution in Europe – Yours to Discover
RA Dr. Wolfgang Deuchler, LL.M.
STEUERN AKTUELL
10 Steuerklauseln im KG Vertrag überprüfen
StB Dr. Volker Streu, RA Dr. Sebastian Garbe
11 Voller Vorsteuerabzug für Führungsholdinggesellschaften
und EU-Rechtswidrigkeit der deutschen Regelung zur
umsatzsteuerlichen Organschaft
StB Daniel Fengler, RA Marc Nürnberger
12 Bundesverfassungsgericht erklärt die Ersatzbemessungs-
grundlage im Grunderwerbsteuerrecht rückwirkend
für verfassungswidrig
StB Daniel Fengler, RA Marc Nürnberger
13 Risiko der Nacherklärung bei Erbfällen
RA StB Jürgen E. Milatz, RA Matthias Wegmann
14 Sanierungssteuerrecht: Neue Entwicklungen bei
Schuldenschnitt und Rangrücktritt
RA StB Dr. Robert Kroschewski, RA Marc Nürnberger
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL
14 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz ist in Kraft getreten
WPin StBin Beatrix Arlitt, StBin Britta Zelder
INTERN
02 Veranstaltungen
16 In eigener Sache
blog.esche.de
Aktuelle Informationen aus Recht,
Steuern und Wirtschaftsprüfung
JETZT NEU
compact III-2015.indd 1 compact III-2015.indd 1 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
2
Forum Arbeitsrecht
Schluss machen – aber richtig!
Mittwoch, 09.09.2015, 17:30 Uhr und Mittwoch, 16.09.2015, 17:30 Uhr
Forum Commercial
Unternehmen am Pranger – Schutz vor rufschädigenden Äußerungen im
Internet
Donnerstag, 10.09.2015, 17:30 Uhr
Workshop Stiftungen/Gemeinnützige Organisationen
„Do‘s and Don‘ts“ im Spendenrecht – Aktuelle Praxistipps für Non-Profi t-
Organisationen
Donnerstag, 17.09.2015, 8:30 Uhr
Workshop Arbeitsrecht
Beteiligung des Betriebsrats: von der Einstellung bis zur Kündigung
Montag, 21.09.2015, 10:00 Uhr
Veranstaltungen im Ausblick
Wir laden Sie herzlich ein zu folgenden Veranstaltungen:
Alle Veranstaltungen fi nden statt bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg.
Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldemöglich keiten fi nden Sie unter
esche.de/veranstaltungen.
INTERN
Kontakt für weitere Infos:
Dr. Frank Tremmel
Tel +49 (0)40 36805-133
f.tremmel@esche.de
compact III-2015.indd 2 compact III-2015.indd 2 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
3
Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben die Sommerpause genutzt, um für Sie in gewohnter Weise Aktuelles aus
den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung zusammenzustellen. Neben
den zukünftig nur noch dreimal im Jahr erscheinenden ESCHE compact Ausgaben
gibt es seit dem 01.07.2015 für Sie die Möglichkeit, sich über unseren neuen Blog
unter blog.esche.de über (tages)aktuelle Rechtsprechungen und Entwicklungen zu
informieren (siehe Seite 16).
Im September laden wir Sie wieder zu zahlreichen Vortragsveranstaltungen und
Workshops ein. Eine Übersicht über die Themen und Termine sehen Sie auf Seite 2.
Details zu den einzelnen Veranstaltungen stellen wir Ihnen auf unserer Webseite
zur Verfügung.
Über esche.de/aktuelles-veranstaltungen/newsletter können Sie Einladungen zu
Veranstaltungen und unsere Publikationen auch kostenfrei abonnieren.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Redaktionsteam
compact III-2015.indd 3 compact III-2015.indd 3 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
4
RECHT AKTUELL
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in der kürzlich ergange-
nen Entscheidung „Uhrenankauf im Internet“ (BGH GRUR
2015, 606 ff.) erstmals entschieden, dass die Einrichtung
einer sogenannten „allgemeinen Markenbeschwerde“ bei
Google zulässig ist und nicht per se andere Marktteilnehmer
in unlauterer Weise behindert.
In dem vom BGH zu beurteilenden Fall hatte sich ein Wie-
derverkäufer gebrauchter Original „ROLEX“-Uhren mit Erfolg
dagegen gewehrt, dass ihm die Verwendung der Marke
„ROLEX“ als Google AdWords von der Markeninhaberin
verweigert wurde. Diese hatte die Verwendung der Marke
„ROLEX“ im Rahmen von Google AdWords-Anzeigen bei
Google für jedermann sperren lassen und eine Verwendung
durch den Wiederverkäufer trotz Nachfrage verweigert. Der
Wiederverkäufer konnte deshalb nicht auf sein Verkaufsange-
bot im Rahmen einer Google AdWords-Anzeige hinweisen.
Der BGH urteilte, dass die Einrichtung einer allgemeinen
Markenbeschwerde bei Google, d. h. die grundsätzliche
Sperrung einer Marke als Google AdWords, nicht den Tat-
bestand der gezielten unlauteren Behinderung von Mitbe-
werbern nach § 4 Nr. 10 UWG (Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb) erfülle. Die allgemeine Markenbeschwerde
verfolge das legitime Ziel, Verletzungen von Markenrechten
durch im Internet erscheinende Anzeigen zu verhindern.
Hierbei handele es sich um eine wettbewerbsimmanente
Handlungsbeschränkung und nicht um eine unlautere Behin-
derung der Entfaltungsmöglichkeiten.
Markeninhabern sei eine effektive Durchsetzung ihrer
Markenrechte im Internet wegen der Vielzahl und Vielfäl-
Google AdWords: Bundesgerichtshof stärkt Rechte
der Markeninhaber
tigkeit potentieller Verletzungshandlungen ohne die Option
einer allgemeinen Markenbeschwerde bei Google kaum
möglich.
Soweit Mitbewerber infolge der allgemeinen Markenbe-
schwerde daran gehindert werden, bestimmte AdWords-
Anzeigen zu veröffentlichen, können sie sich an den Marken-
inhaber wenden und um Zustimmung zu ihrer Werbung
bitten.
Eine gezielte Behinderung von Mitbewerbern komme aber
dann in Betracht, wenn der Markeninhaber (wie im zu ent-
scheidenden Fall) die Zustimmung im Einzelfall verweigert,
obwohl seine Markenrechte durch die beabsichtigte Wer-
bung nicht verletzt werden. Insofern obliege dem Marken-
inhaber eine Prüfungspfl icht.
Die wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten des Mit-
bewerbers werden also, so der BGH, durch die verweigerte
Zustimmung der Markeninhaberin unmittelbar beeinträch-
tigt, wenn die beabsichtigte Werbung markenrechtlich zulässig
ist. Die Sperrung der Marke diene dann nicht in erster Linie
der Förderung des eigenen Wettbewerbs, sondern ziele auf
die Behinderung des Mitbewerbers ab.
– Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford) –
Sperrung von Marken als Google AdWords ist grundsätzlich zulässig
Kontakt für weitere Infos:
RA Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-361
r.moeller@esche.de
compact III-2015.indd 4 compact III-2015.indd 4 24.08.15 13:5324.08.15 13:53
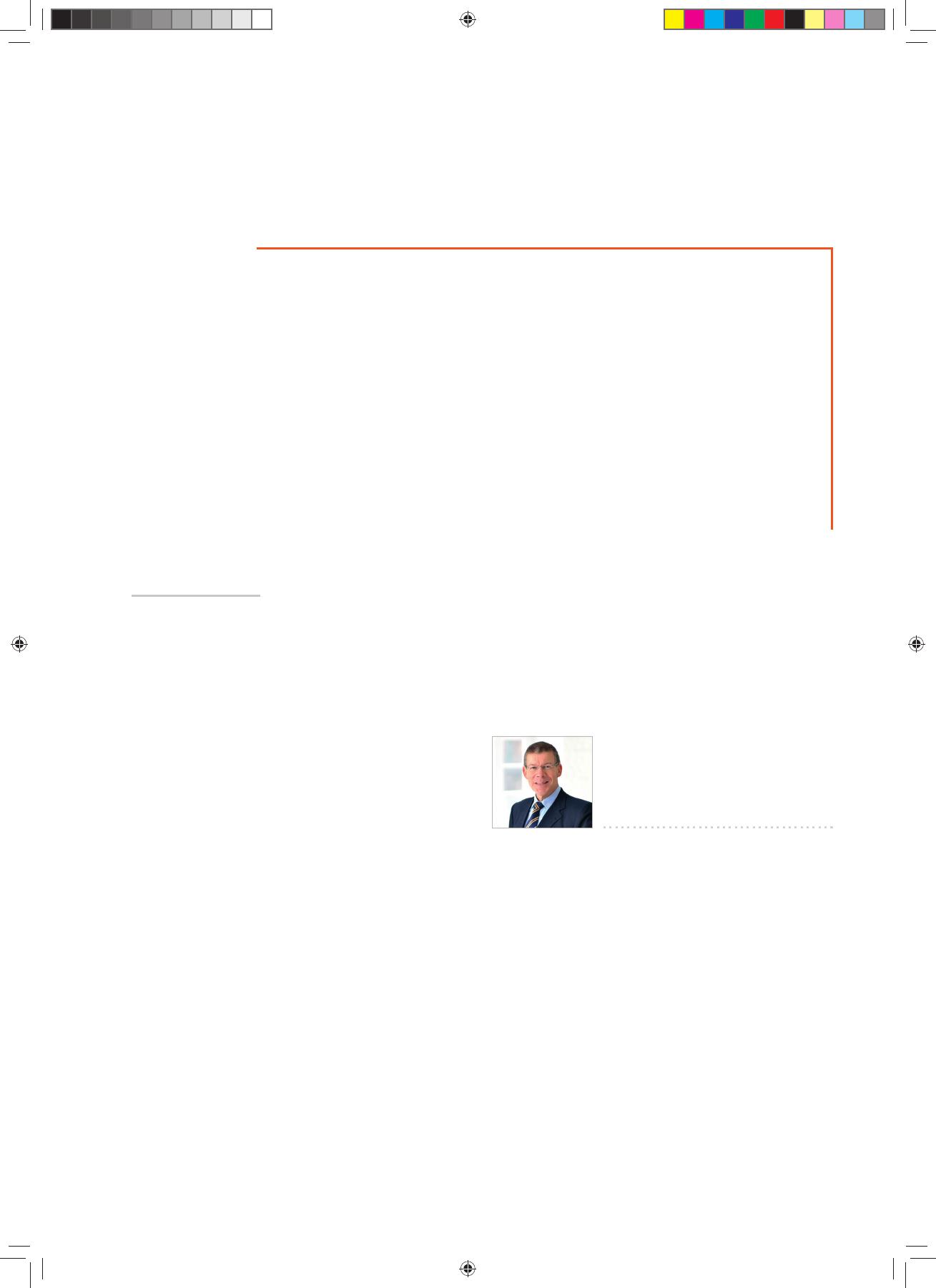
ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
5
PRAXISTIPPS
Die begrüßenswerte Entscheidung des BGH stärkt die Rechte von Markeninhabern. Bislang war strittig, ob die bloße Teil-
nahme an der allgemeinen Markenbeschwerde von Google bereits eine unlautere Behinderung darstellt. Dieser Auffassung
hat der BGH nun eine klare Absage erteilt.
Markeninhaber können also künftig ihre Marke bei Google sperren und so grundsätzlich verhindern, dass Dritte diese im
Rahmen eigener AdWords-Anzeigen, z. B. zur Bewerbung von Fälschungen oder zur Bewerbung von Wettbewerbsprodukten,
einsetzen.
Allerdings darf der Markeninhaber auch weiterhin nicht eine markenrechtlich zulässige Verwendung seiner Marke verhindern,
indem er seine Zustimmung zur Nutzung trotz Nachfrage verweigert. Verkäufer von Originalware haben also das Recht, die
betreffende Marke zur Bewerbung ihrer Angebote im Rahmen von AdWords-Anzeigen zu verwenden.
Machen Markeninhaber von der allgemeinen Markenbeschwerde Gebrauch, müssen sie deshalb ein effektives Prüfungs-
system etablieren und markenrechtlich zulässige Werbeanzeigen auf Nachfrage freischalten. Eine Verweigerung und wohl
auch eine nur zeitlich deutlich verzögerte Zustimmung können u. a. lauterkeitsrechtliche Unterlassungs- und Schadens-
ersatzansprüche zur Folge haben. Hier ist Vorsicht geboten, denn die Beurteilung, ob eine konkrete Werbeanzeige marken-
rechtlich zulässig ist, erfordert in aller Regel eine juristische Prüfung.
RECHT AKTUELL
Im April 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern an Führungspositionen in
der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft
getreten. Es dient vor allem dem Zweck, den Anteil weibli-
cher Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft zu erhö-
hen. Der Gesetzgeber tritt hier insbesondere auf den Plan,
weil bisher entsprechende freiwillige Selbstverpfl ichtungen
der Unternehmen nicht die gewünschte Wirkung erzielt
und zu keiner nennenswerten Erhöhung des Frauenanteils
an Führungspositionen geführt haben.
Pfl ichten erwachsen hieraus insbesondere für börsennotierte
oder der Mitbestimmung unterliegende Aktiengesellschaften
bereits bis Ende September 2015. Bis dahin hat der Aufsichts-
rat für sich und den Vorstand sowie der Vorstand für die
nächsten beiden Führungsebenen des Unternehmens soge-
nannte Zielgrößen zu benennen, in welchem Umfang künftig
eine angemessene Beteiligung von Frauen angestrebt wird.
Gleichzeitig sind Fristen für die Erreichung der Zielgrößen
festzulegen. Ein erreichter Frauenanteil von unter 30 % darf
im Rahmen der Festsetzung der genannten Zielgrößen nicht
Gesetz zur „Frauenquote“ in Kraft getreten
Pfl icht zur Benennung von Zielgrößen für den Frauenanteil an Führungspositionen von Unternehmen
der Privatwirtschaft
Kontakt für weitere Infos:
RA Dr. Hans Mewes
Tel +49 (0)40 36805-132
h.mewes@esche.de
mehr reduziert, sondern allenfalls beibehalten oder gesteigert
werden. Die festgelegten Zielgrößen, deren Erreichung oder
Nichterreichung und die hierfür einzuhaltenden Fristen haben
die Unternehmen künftighin innerhalb des zum Lagebericht
gehörenden Berichts zur Unternehmensführung gemäß
§ 289a Handelsgesetzbuch offenzulegen. Im Falle der Nichter-
reichung der Zielgrößen sind die Gründe hierfür bekannt zu
machen (Prinzip des „comply or explain“ sowie des „naming
and shaming“). Soweit die betreffenden Gesellschaften
sowohl börsennotiert als auch paritätisch mitbestimmt sind,
ist zudem ab 2016 bei der Besetzung neuer Aufsichtsratspos-
ten eine verbindliche Quote von mindestens 30 % für beide
Geschlechter einzuhalten. Wenn dies nicht gelingt, droht die
Nichtigkeit einer Wahl zum Aufsichtsrat und ein unbesetzter
Posten („leerer Stuhl“).
compact III-2015.indd 5 compact III-2015.indd 5 24.08.15 13:5324.08.15 13:53
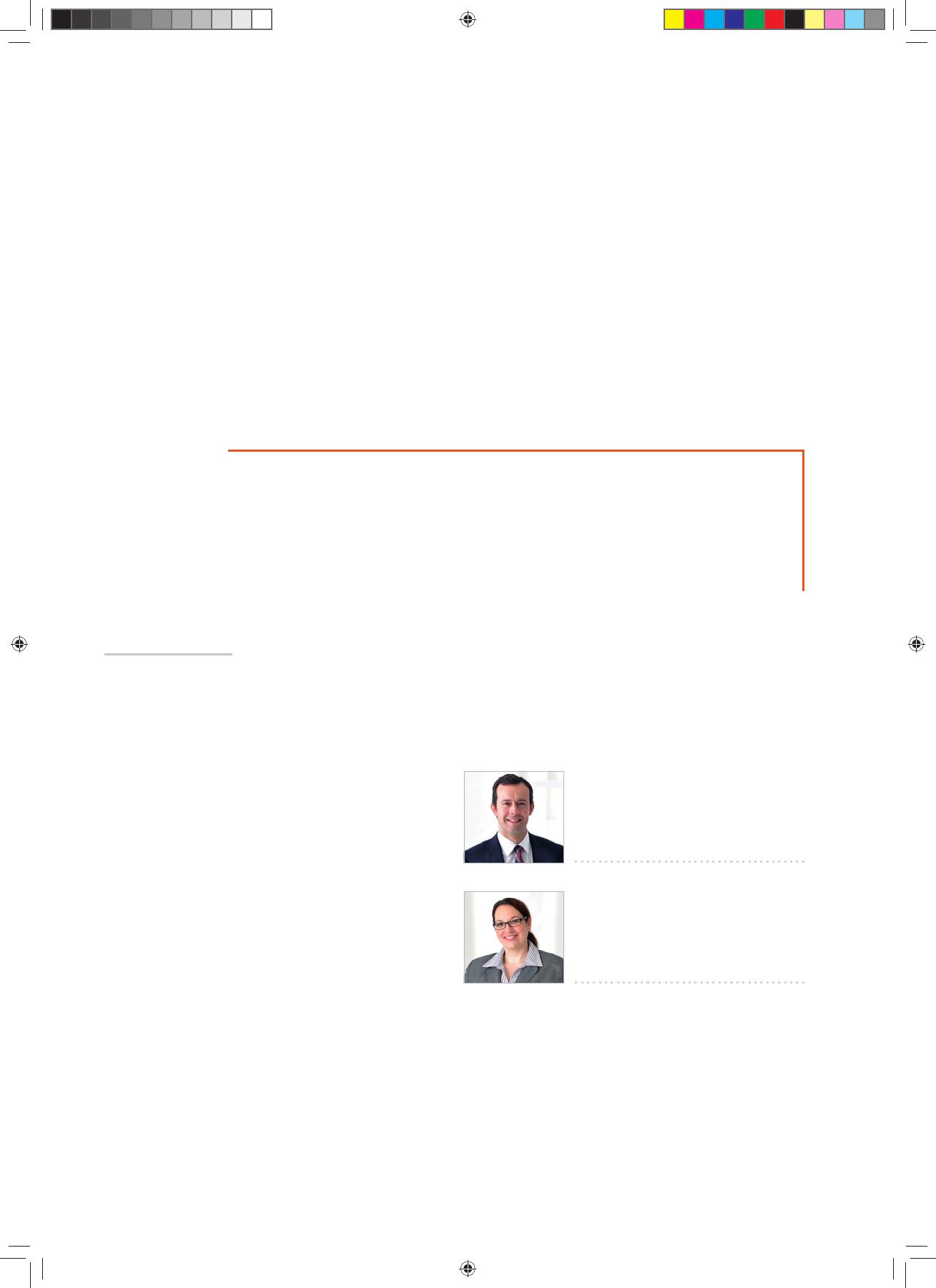
ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
6
Kontakt für weitere Infos:
RAin Anke Wilhelm, LL.M.
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-140
a.wilhelm@esche.de
In der Sache räumt das neue Recht einen weiten Gestal-
tungsspielraum ein, wobei die konkrete Umsetzung mög-
lichst umfassend dokumentiert werden sollte. Beispiels-
weise könnte eine Zielgröße für den Vorstand auch bei
„Null Prozent“ liegen, wenn dies bislang so ist und sich in
den nächsten Jahren dort auch kein Wechsel abzeichnet.
In jedem Fall sollten auf der Grundlage des ermittelten
„Status Quo“ in einem ersten Schritt die erforderlichen
Beschlüsse von Aufsichtsrat und Vorstand herbeigeführt
werden, aus denen sich erstmalig die entsprechenden Ziel-
größen ergeben, die zunächst bis (längstenfalls) Ende Juni
2017 zu erreichen sind. Besonderheiten könnten sich dabei
namentlich für Konzerngesellschaften und für Unterneh-
men mit einer fl achen Hierachie im Hinblick auf die Beset-
zung der dem Vorstand nachgelagerten beiden Führungs-
ebenen ergeben.
– Dr. Hans Mewes –
PRAXISTIPPS
Unternehmen, die dem Anwendungsbereich des neuen Gesetzes unterliegen, sollten zügig die spezifi schen Anforderungen
und Auswirkungen auf die jeweilige Unternehmensstruktur ermitteln und erste Beschlussfassungen hinsichtlich der Fest-
legung der Zielgrößen auf den verschiedenen Gesellschaftsebenen herbeiführen. Zu beachten ist, dass die neue Rechtslage
insbesondere gesellschafts-, kapitalmarkt- und arbeitsrechtliche Implikationen mit sich bringt und in das Complianceregime
des Unternehmens einzubeziehen ist. Das neue Recht sollte insbesondere auch von Unternehmen frühzeitig ins Kalkül
gezogen werden, die in der nächsten Zeit einen Börsengang bzw. eine Zulassung ihrer Aktien zum regulierten Markt beab-
sichtigen.
RECHT AKTUELL
Gegen eine unmittelbare Patentverletzung, d. h. die unbe-
rechtigte Benutzung sämtlicher Merkmale einer patentge-
schützten Erfi ndung, kann der Patentinhaber u. a. Ansprüche
auf Unterlassung und Schadensersatz geltend machen.
Nach den Grundsätzen der mittelbaren Patentverletzung
haftet – in eingeschränktem Umfang – auch derjenige, der
Mittel anbietet und/oder liefert, die sich auf ein wesentliches
Element der patentgeschützten Erfi ndung beziehen. Solche
Mittel können beispielsweise Komponenten des patentge-
schützten Erzeugnisses oder auch Vorrichtungen sein, mit
denen ein geschütztes Verfahren angewendet oder einzelne
Verfahrensschritte durchgeführt werden können.
Dabei kann ein Patent grundsätzlich nur gegen Verletzungs-
handlungen in seinem territorialen Geltungsbereich geltend
gemacht werden. Im Falle der mittelbaren Verletzung muss
sogar ein sogenannter doppelter Inlandsbezug gegeben sein.
Sowohl die durch das Mittel geförderte unmittelbare
Patentverletzungshandlung als auch das Anbieten und/oder
Liefern des Mittels müssen im Geltungsbereich des Patents
erfolgen. Andernfalls scheidet eine mittelbare Verletzung
des inländischen Patents aus.
Mit der Frage der mittelbaren Patentverletzung durch die
Lieferung von verschiedenen Geräten aus China nach
Deutschland beschäftigte sich der Bundesgerichtshof (BGH)
Bundesgerichtshof zur mittelbaren Patentverletzung
durch Lieferung aus dem Ausland
Kontakt für weitere Infos:
RA John Sebastian Chudziak, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-142
j.chudziak@esche.de
compact III-2015.indd 6 compact III-2015.indd 6 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
7
PRAXISTIPPS
Auch Handlungen im Ausland können zu einer Haftung wegen Verletzung eines territorial begrenzten, inländischen Schutz-
rechts führen. Sobald Kenntnis davon gegeben ist, dass mit der eigenen Handlung Verletzungshandlungen im Inland veranlasst
werden, wird die ausländische Handlung haftungsträchtig. Dies gilt nach dem besprochenen Urteil des BGH nicht nur für
unmittelbare, sondern auch für mittelbare Patentverletzungen. Zur Vermeidung von Haftungsrisiken sollten deshalb auch
ausländische Vertriebshandlungen einer patentrechtlichen Prüfung unterzogen werden, jedenfalls dann, wenn mögliche weitere
Abnehmer im Inland sitzen.
in seiner Entscheidung „Audiosignalcodierung“ vom
03.02.2015 (Az.: X ZR 69/13). Die Klägerin ist Inhaberin
eines europäischen Patents mit Gültigkeit in Deutschland,
das ein Verfahren zur Codierung, Übertragung und Deco-
dierung von Audiodaten schützt. Verklagt war ein in China
ansässiger Hersteller, der Empfangsgeräte für patentgemäß
codierte Audiodaten an ein Vertriebsunternehmen in
Deutschland lieferte sowie an ein anderes Unternehmen
in China, das die Geräte ebenfalls an ein in Deutschland
ansässiges Vertriebsunternehmen lieferte.
In seiner Entscheidung stellte der BGH zunächst fest, dass
beide von China aus getätigten Lieferungen der Beklagten
relevante Benutzungshandlungen im Inland darstellen. Ein im
Ausland ansässiger Lieferant sei für eine in Deutschland
begangene Patentverletzung verantwortlich, wenn er ein
geschütztes Erzeugnis an einen in Deutschland ansässigen
Abnehmer liefert, und zwar unabhängig davon, an welchem
Ort Eigentum, Besitz und Gefahr an der gelieferten Ware
auf den Abnehmer übergehen. Dies gelte auch für die mit-
telbare Patentverletzung, weil diese ebenfalls an die Liefe-
rung eines bestimmten Gegenstands (hier: des Mittels) ins
Inland anknüpfe.
Demnach sei die direkte Lieferung der Beklagten an das deut-
sche Unternehmen eindeutig eine inländische Verletzungs-
handlung. Aber auch die Lieferung an das in China ansässige
und nach Deutschland exportierende Unternehmen sei letzt-
lich eine Inlandshandlung der Beklagten, weil sie wusste, dass
ihr Abnehmer die Geräte möglicherweise auch nach Deutsch-
land exportiere. Die Beklagte hatte das chinesische Unter-
nehmen auf ihrer Webseite selbst als ihren Distributor für den
europäischen Markt bezeichnet. Für den BGH war damit klar,
dass die Beklagte an der von ihrem unmittelbaren Abnehmer
veranlassten Lieferung nach Deutschland durch eigenes vor-
werfbares Verhalten mitgewirkt habe und deshalb hafte.
– John Sebastian Chudziak, LL.M. – Anke Wilhelm, LL.M. –
Kontakt für weitere Infos:
RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
j.ingerowski@esche.de
RECHT AKTUELL
Ein Unternehmen, das Sekundärbrennstoffe aus Haus- und
Sperrmüll sowie Baustellenabfällen herstellt, ist kein Unter-
nehmen des produzierenden Gewerbes und hat daher kei-
nen Anspruch auf Begrenzung der EEG-Umlage 2013, so
das Verwaltungsgericht Frankfurt/Main mit Urteil vom
06.05.2015.
Das Unternehmen hatte beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Begrenzung der EEG-
Umlage 2013 beantragt. Seiner Ansicht nach sei es ein privi-
legiertes Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Die
Herstellung von Sekundärbrennstoffen zähle zum Abschnitt C
Erzeugung von Ersatzbrennstoffen: kein Anspruch
auf Begrenzung der EEG-Umlage
compact III-2015.indd 7 compact III-2015.indd 7 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
8
(„Verarbeitendes Gewerbe“) der Klassifi kation der Wirt-
schaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008,
auf die die §§ 40 ff. in Verbindung mit § 3 Nr. 14 Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) 2012 verweisen, und sei der
Untergruppe 32.99.0 („Herstellung von sonstigen Erzeug-
nissen“) zuzuordnen.
Entscheidend für die Einordnung als produzierendes
Gewerbe sei aus seiner Sicht, dass am Ende der Tätigkeit ein
neues Erzeugnis stehe. Dies sei bei der mechanischen
Umwandlung heizwertreicher Abfälle unter Einhaltung fest
defi nierter Produkteigenschaften, insbesondere nach festge-
legten RAL-Gütebestimmungen der Fall. Als Vergleichsbei-
spiel könne die Herstellung von Holzpellets dienen.
Das BAFA lehnte den Antrag auf Begrenzung der EEG-
Umlage mit der Begründung ab, das Unternehmen sei kein
Unternehmen des produzierenden Gewerbes im Sinne des
EEG 2012. Es behandele Restabfälle, die letztendlich durch
Verbrennung oder den Einsatz als Substitut beseitigt würden.
Das Unternehmen sei Abschnitt E („Wasserversorgung;
Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von
Umweltverschmutzungen“), dort Untergruppe 38.21.0
(„Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle“)
zuzuordnen.
Das Verwaltungsgericht folgte der Auffassung des BAFA und
wies die Klage ab. Das Unternehmen sei kein Unternehmen
des produzierenden Gewerbes, denn es gehe weder dem
Bergbau oder der Gewinnung von Steinen und Erden nach,
noch sei es dem verarbeitenden Gewerbe nach Abschnitt B
und Abschnitt C der Klassifi kation der Wirtschaftszweige
zuzuordnen. Die in Abschnitt C, Untergruppe 32.99.0
(„Herstellung von sonstigen Erzeugnissen“) aufgelisteten
Erzeugnisse hätten keine Ähnlichkeit mit den Ersatzbrenn-
stoffen der Klägerin. Für die Einordnung in diesen Abschnitt
reiche es nicht aus, dass sich die Unternehmenstätigkeit in
einem Herstellungsverfahren und -ergebnis abbildet – maß-
geblich sei vielmehr die Zweckrichtung der Tätigkeit, die hier
in der Behandlung und Beseitigung von Abfällen bestehe
und nicht in der Warenproduktion. Eine Verarbeitung von
Abfällen zu Sekundärbrennstoffen sei auch dann keine
Warenproduktion, wenn Abfälle physikalisch oder chemisch
umgewandelt würden.
– RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M –
PRAXISTIPPS
Das aktuelle Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt/Main steht in einer Reihe mit zahlreichen anderen Entscheidungen des
Gerichts, in denen eine Begrenzung der EEG-Umlage für Unternehmen der Abfallwirtschaft, die Abfälle einer Weiterverwer-
tung zuführen, abgelehnt wurde. Es bleibt dabei, dass „produzierendes Gewerbe“ äußerst eng ausgelegt wird. Maßgeblich
heranzuziehen ist, welche Zweckrichtung die Unternehmenstätigkeit verfolgt: Abfallentsorgung oder Warenproduktion.
RECHT AKTUELL
Most North American lawyers consider the numerous judi-
cial systems in Europe as a territory which should be
avoided. They have the impression that arbitration may be a
better alternative. This may be a valid consideration with
regards to those European countries in which the judicial
Dispute Resolution in Europe – Yours to Discover
Kontakt für weitere Infos:
RA Dr. Wolfgang Deuchler, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-125
w.deuchler@esche.de
International
An address to North American Lawyers
X)
compact III-2015.indd 8 compact III-2015.indd 8 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
9
X)
Excerpt from a presentation given to North American Lawyers at the 2015 Americas Regional Meeting of Lawyers Associated Worldwide (LAW) in Calgary/Canada.
systems are extremely slow. On the other hand, it must be
noted that many European countries have well-organized
and effi cient court systems. Therefore, it seems worthwhile
to have a look at the unknown territory of litigation at Euro-
pean state courts by pointing out four characteristic differ-
ences between the judicial systems in Continental Europe
and North America.
1. No Jury / No Excessive Damages
In civil or commercial matters a jury of laymen does not
exist in European legal systems. Every case is heard by pro-
fessional judges only. The courts often have specialized
chambers, for instance for patent matters, intellectual prop-
erty or banking law matters. Many judges are experienced
in international matters and are willing to accept the pres-
entation of English documents without translation. Proce-
dural rules lead to a timely process. In civil and commercial
matters, a court chamber will often handle several different
cases on one court day. In Germany, it is the intention of the
law to conclude a matter in one instance by holding only
one, at most two hearings. In addition, it is important to
note that European laws do not grant punitive damages and
that damages for pain and suffering, mental distress etc. are
limited to comparatively small amounts. All of this makes the
fi nancial risks of litigation in Europe less costly and time-
consuming and more predictable and quantifi able than in
North America.
2. No Contingency Fee
As a general rule, European lawyers do not work on a con-
tingency fee basis. In some cases, there may be fee arrange-
ments which refl ect the outcome of the case. But generally,
litigation lawyers charge either on time or agreed fee basis.
In many countries, like in Germany, the losing party has to
pay not only its own lawyer, but also the court fees and the
opponent lawyer‘s fees. But the amounts which the success-
ful party may recover as legal expenses from the opponent
may be limited.
3. No Discoveries
It is diffi cult to comprehend for any North American lawyer:
Continental Europe does not know any pre-trial discoveries.
This means that anyone starting litigation does not know
the cards – or at least all of the cards – which the opponent
is holding in his or her hand. However, once litigation is
pending, the court may in some cases order the defendant
to present certain documents. And there are extensive rules
of evidence which often shift the burden of proof, i.e. the
burden to present facts and documents, on the defendant.
4. The Role of the Judge
Judicial systems in Continental Europe are not strictly adver-
sarial but have a mixture of adversarial, conciliatory and
inquisitorial elements. In particular, the judge takes a more
active role in leading the process and guiding the parties.
Judges have a strong tendency to make the parties reach an
amicable settlement. If the matter is not settled, the out-
come of the litigation depends greatly on the judge‘s evalu-
ation of the parties‘ written submissions, whereas oral pres-
entations play a rather insignifi cant role. In Germany,
procedural rules are designed to narrow the whole dispute
down to possibly only one or two specifi c issues which are
actually decisive. Accordingly, evidence is taken only on
points which are relevant for the outcome of the dispute.
This often safes the parties from having to disclose a lot of
information which may not be relevant in the end for the
outcome of the lawsuit, as it may happen in North Ameri-
can pre-trial discoveries.
– Dr. Wolfgang Deuchler, LL.M. –
compact III-2015.indd 9 compact III-2015.indd 9 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
10
Kontakt für weitere Infos:
StB Dr. Volker Streu
Fachberater für Internationales Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-0
v.streu@esche.de
Kontakt für weitere Infos:
RA Dr. Sebastian Garbe
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Tel +49 (0)40 36805-226
s.garbe@esche.de
STEUERN AKTUELL
Änderungen in der Steuergesetzgebung und -rechtsprechung
erfordern regelmäßig die Überprüfung von Gesellschafts-
verträgen beziehungsweise Satzungen, insbesondere bei der
GmbH & Co. KG. Bei Personengesellschaften fallen nämlich
Verursacher und Zahler der Gewerbesteuer häufi g ausein-
ander. Die Gewerbesteuerpfl icht liegt auf der Gesellschafts-
ebene, dort ist die Gewerbesteuer Aufwand und mindert
den zu verteilenden Gewinn. Die Steuerbelastung kann aber
in der Einkünfteerzielung nur eines Gesellschafters begrün-
det sein, etwa in den Vergütungen für geleistete Dienste
oder in der Überlassung von Kapital oder anderen Wirt-
schaftsgütern, die ein Gesellschafter erhält. Diese handels-
rechtlichen Aufwendungen erhöhen als Sonderbetriebsein-
nahmen den Gewinn aus Gewerbebetrieb und somit die
Höhe der Gewerbesteuer der Gesellschaft.
Etwas anders gelagert ist die Problematik künftig bei Ein-
bringungen: Nach dem sogenannten Jahressteuergesetz
2016 sollen künftig Einbringungen von Betrieben oder Mit-
unternehmer-Anteilen in eine GmbH & Co. KG oder Kapi-
talgesellschaft nur noch dann zum Buchwert erfolgen, wenn
die gegebenenfalls neben Gesellschaftsanteilen gewährten
sogenannten sonstigen Leistungen nicht mehr als 25 % des
Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder
nicht mehr als € 300.000 betragen. Im Gesellschaftsvertrag
ist darauf zu achten, dass die Kapitalerhöhung beim Festka-
pital und/oder dem variablen Kapital mit gesamthänderi-
scher Bindung erfolgt. Eine Gutschrift auf einem Gesellschaf-
terkonto mit Fremdkapitalcharakter würde als sonstige
Leistung qualifi ziert werden.
Unabhängig von einer Einbringung kann die Überprüfung
von Gesellschaftsverträgen in steuerlicher Hinsicht geboten
sein, wenn die Gesellschafter eine verursachungsgerechte,
d. h. auf den verursachenden Gesellschafter bezogene
Berücksichtigung steuerlichen Aufwands bei der Gewinnver-
teilung erreichen wollen. Neben Bestimmungen zur Entnahme
von Steuerzahlungen und zum Ausgleich der Gewerbe-
steuer auf Sondervergütungen sollten Gesellschaftsverträge
von Kommanditgesellschaften die folgenden „Impulse“ des
Steuergesetzgebers berücksichtigen: die Begünstigung der
Thesaurierung von Gewinnen bei Personengesellschaften
(§ 34a Einkommensteuergesetz (EStG)), die Anrechnung
pauschalierter Gewerbesteuerbeträge auf die Einkommen-
steuer (§ 35 EStG) und die Aufhebung der engen Bindung
der Handelsbilanz an die Steuerbilanz (Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz), mit der Folge eines vermehrten Ausweises
aktiver oder passiver latenter Steuern im Jahresabschluss.
Regelungen im Gesellschaftsvertrag dürften die Steuerlast
zwar nicht senken, aber dazu beitragen, die Steuerbelastung
und die Aufteilung der Einkünfte zwischen den Gesellschaf-
tern in Einklang zu bringen.
– Dr. Volker Streu – Dr. Sebastian Garbe –
Steuerklauseln im KG Vertrag überprüfen
FAZIT
Die für Herbst erwartete Verabschiedung des sogenannten Jahressteuergesetzes 2016 ist ein geeigneter Anlass für die Prüfung
von Gesellschaftsverträgen auf Aktualität der Steuerklauseln. Tritt ein neuer Gesellschafter in eine KG ein, sollten die Steuer-
klauseln im Gesellschaftsvertrag stets an die neue Situation angepasst werden.
compact III-2015.indd 10 compact III-2015.indd 10 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
11
FAZIT
Führungsholdings können nunmehr, explizit durch den EuGH bestätigt, (u. a.) bei wirtschaftlicher Tätigkeit gegenüber ihren Betei-
ligungsgesellschaften, die über das bloße Erwerben und Halten von Gesellschaftsanteilen hinausgeht, bei entsprechenden Aus-
gangsumsätzen grundsätzlich den vollen Vorsteuerabzug vornehmen. Unsicher und mit Spannung abzuwarten bleibt, wie die
nationalen Finanzgerichte die Voraussetzungen zur Anerkennung einer umsatzsteuerlichen Organschaft künftig auslegen und ob
und wann der deutsche Gesetzgeber diesbezüglich aktiv wird.
STEUERN AKTUELL
Das bloße Erwerben und Halten von Gesellschaftsanteilen
durch eine Holdinggesellschaft stellt umsatzsteuerlich
grundsätzlich keine Leistung dar, so dass diese für entspre-
chende Aufwendungen keine Vorsteuer in Abzug bringen
kann. Sofern seitens der Holdinggesellschaft als sogenannte
Führungsholding darüber hinaus aber entgeltlich administra-
tive, kaufmännische, fi nanzielle oder technische Dienstleis-
tungen erbracht werden, ging die Besteuerungspraxis bisher
davon aus, dass der Vorsteuerabzug für diese wirtschaftliche
Tätigkeit insoweit zulässig ist, wie die Aufwendungen der
Führungsholding der wirtschaftlichen Tätigkeit zugerechnet
werden können. Die Frage der genauen Berechnungsme-
thode hat der Bundesfi nanzhof (BFH) dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) vorgelegt.
Mit Urteil vom 16.07.2015 hat der EuGH geantwortet, dass
bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit die Führungs-
holding grundsätzlich in vollem Umfang Vorsteuer für Kosten
im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung abzie-
hen kann. Nur soweit eine Holding mehrere Tochtergesell-
schaften hält und nicht für alle wirtschaftlich tätig wird oder
umsatzsteuerfreie Ausgangsumsätze leistet, bleibt der Vor-
steuerabzug anteilig verwehrt. Als wirtschaftliche Tätigkeit
gilt dabei eine Teilnahme an der Verwaltung der Tochterge-
sellschaft, die über das Maß hinausgeht, welches ein Gesell-
schafter aufgrund seiner Gesellschafterstellung vornimmt.
Ferner hat der BFH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die
Beschränkung von Organgesellschaften auf juristische Perso-
nen im deutschen Umsatzsteuerrecht (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG)
dem EU-Recht entspricht. Der EuGH sieht die deutsche
Regelung als EU-rechtswidrig an, da nach der europäischen
Voller Vorsteuerabzug für Führungsholdinggesell-
schaften und EU-Rechtswidrigkeit der deutschen
Regelung zur umsatzsteuerlichen Organschaft
Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht ausschließlich juristi-
sche, sondern jede Person Teil einer sogenannten Mehrwert-
steuergruppe (europarechtlicher Terminus der umsatzsteuer-
lichen Organschaft) sein kann. Auch das deutsche Erfordernis
einer Über-/Unterordnung von Organträger und Organge-
sellschaft geht über die Anforderung des EU-Rechts hinaus,
das lediglich eine „enge Verbindung“ verlangt. Eine nationale
Beschränkung ist nur zulässig, wenn sie zur Vermeidung von
Missbrauch und Steuerhinterziehung erforderlich und geeig-
net ist. Die Notwendigkeit einer solchen Missbrauchsregelung
hat der BFH als vorlegendes Gericht festzustellen.
Ferner stellt der EuGH klar, dass sich Steuerpfl ichtige dies-
bezüglich nicht unmittelbar auf das europäische Recht beru-
fen können, da die EU-Regelung nicht hinreichend genug
bestimmt ist. Das EU-rechtliche Erfordernis einer „engen
Verbindung“ ist eine bedingte Bestimmung, die der nationale
Gesetzgeber noch präzisieren muss.
– Daniel Fengler – Marc Nürnberger –
Kontakt für weitere Infos:
StB Daniel Fengler
Tel +49 (0)40 36805-411
d.fengler@esche.de
Kontakt für weitere Infos:
RA Marc Nürnberger
Tel +49 (0)40 36805-414
m.nuernberger@esche.de
compact III-2015.indd 11 compact III-2015.indd 11 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
12
STEUERN AKTUELL
Beim unmittelbaren Kauf eines Grundstücks bemisst sich die
Höhe der Grunderwerbsteuer grundsätzlich nach dem
Kaufpreis (Regelbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1
Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG)). Im Rahmen von
Unternehmenstransaktionen werden (Betriebs-)Grund-
stücke jedoch regelmäßig nicht unmittelbar aufgrund eines
gesonderten Kaufvertrags übertragen, sondern sind mittel-
bar Bestandteil eines Erwerbs auf gesellschaftsrechtlicher
Grundlage, einer Änderung des Gesellschafterbestands
einer Personengesellschaft oder einer Anteilsübertragung.
In diesen Fällen der unmittelbaren Grundstücksübertragung
bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach einer sogenannten
Ersatzbemessungsgrundlage (§ 8 Abs. 2 GrEStG).
Bei der Ersatzbemessungsgrundlage ist der maßgebliche
Grundbesitzwert als Bedarfswert nach §§ 138 ff. Bewer-
tungsgesetz festzustellen. Nach Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 23.06.2015 ist die Ersatzbemessungs-
grundlage verfassungswidrig, da sie gegenüber der
Regelbemessungsgrundlage eine ungerechtfertigte Privile-
gierung darstellt. Die als Ersatzbemessungsgrundlage ermit-
telten Werte erreichen laut Bundesverfassungsgericht bei
bebauten und unbebauten Grundstücken im Durchschnitt
nur 50 % bzw. 70 % des Verkehrswerts, bei land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen sogar nur 10 %.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber ver-
pfl ichtet, bis zum 30.06.2016 rückwirkend zum 01.01.2009
Bundesverfassungsgericht erklärt die Ersatz-
bemessungsgrundlage im Grunderwerbsteuerrecht
rückwirkend für verfassungswidrig
eine Neuregelung zu treffen. Damit dürfen Gerichte und
Finanzämter die Ersatzbemessungsgrundlage für Sachver-
halte ab 2009 nicht mehr anwenden, laufende Verfahren
sind auszusetzen. Sofern bereits Bescheide über die Grund-
besitzbewertung für Zwecke der Grunderwerbsteuer
ergangen sind, gilt zugunsten der Steuerpfl ichtigen gemäß
§ 176 Abs. 1 S. 1 Abgabenordnung aber ein Vertrauens-
schutz – nach herrschender Meinung und Auffassung der
Finanzverwaltung auch bei Bescheiden unter Vorläufi gkeits-
vermerk. Mit einer nachträglichen Erhöhung bereits veran-
lagter Grunderwerbsteuerfälle ist daher nicht zu rechnen.
In allen künftigen oder noch offenen Fällen ab 2009 müssen
sich die Steuerpfl ichtigen hingegen auf eine Erhöhung der
Grunderwerbsteuer einstellen.
– Daniel Fengler – Marc Nürnberger –
Kontakt für weitere Infos:
StB Daniel Fengler
Tel +49 (0)40 36805-411
d.fengler@esche.de
Kontakt für weitere Infos:
RA Marc Nürnberger
Tel +49 (0)40 36805-414
m.nuernberger@esche.de
Im Rahmen von Unternehmenstransaktionen ist zukünftig mit einer höheren Grunderwerbsteuer
zu rechnen
PRAXISTIPPS
Transaktionen von Unternehmen mit Grundvermögen werden bei künftiger oder noch offener Veranlagung eine höhere,
näher am Verkehrswert orientierte Grunderwerbsteuer auslösen. Trotz Rückwirkung zum 01.01.2009 greift für Steuerpfl ich-
tige bei bereits veranlagten Fälle ein Vertrauensschutz. Bei anhängigen Einspruchsverfahren ist im Hinblick auf eine mögliche
Verböserung durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts – bei entsprechendem Hinweis des Finanzamts – eine
Rücknahme des Rechtsbehelfs zu erwägen.
compact III-2015.indd 12 compact III-2015.indd 12 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
13
STEUERN AKTUELL
Um frühzeitig über erbbedingte Vermögensübertragungen
informiert zu werden, verlangt das Gesetz von allen Erwer-
bern gem. § 30 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
(ErbStG) die Anzeige eines Erbfalls. Die Anzeigefrist beträgt
3 Monate und beginnt mit Kenntnis des Erbfalls. Maßgeblich
ist regelmäßig der Erbschein bzw. die Testamentseröffnung.
Unterlässt der Erblasser die Anzeige kann hierin bereits eine
Steuerhinterziehung im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 2 Abgaben-
ordnung (AO) liegen. Daher kann es von Bedeutung sein,
strafbefreiend die Anzeige nachzuholen.
Die Anzeige ist keine förmliche Steuererklärung. Die Anzeige-
pfl icht soll die möglichst vollständige Erfassung aller Erwerbe
sicherstellen und dient in erster Linie dazu, dem Finanzamt die
Prüfung zu erleichtern, ob und vor allem wen es im Einzelfall
zur Abgabe einer nachfolgenden Steuererklärung aufzufor-
dern hat. Daher sieht § 30 Abs. 4 bestimmte Anforderungen
an die Anzeige vor, die jedoch nicht als zwingend formuliert
sind. Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH)
soll aber regelmäßig die namentliche Bezeichnung des Erblas-
sers, des Erben sowie der Rechtsgrund für den Erwerb ausrei-
chend sein (BFH v. 30.10.1996 – II R 70/94, BStBl. II 1997, 11).
Die Anzeige muss gem. § 35 ErbStG gegenüber dem Erb-
schaftsteuerfi nanzamt des Erblassers erfolgen. Eine Mitteilung
nur an das für die Einkommensteuer zuständige Finanzamt
reicht nicht aus, auch wenn verwaltungsintern die Finanzämter
zur Weiterleitung verpfl ichtet sind.
Die Nachholung der Anzeige kann im Versuchsstadium der Tat
noch nach den strafrechtlichen Regeln des Rücktritts im Sinne
des § 22 Strafgesetzbuch erfolgen; mit Vollendung der Tat ist
dies nur noch über die strafbefreiende Selbstanzeige im Sinne
des § 371 AO möglich. Der Unterschied dieser beiden Rechts-
institute liegt darin, dass beim Rücktritt vom Versuch im Falle
der Nachholung einer Anzeige es bereits ausreichend sein
Risiko der Nacherklärung bei Erbfällen
Die strafbefreiende Nachholung einer unterlassenen Anzeige nach § 30 Abs. 1 ErbStG
Kontakt für weitere Infos:
RA Matthias Wegmann
Tel +49 (0)40 36805-219
m.wegmann@esche.de
Kontakt für weitere Infos:
RA StB Jürgen E. Milatz
Fachanwalt für Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-332
j.milatz@esche.de
kann, das Finanzamt über die Schenkung in Kenntnis zu setzen.
Wird das Finanzamt also entgegen des § 30 Abs. 4 ErbStG
nicht über sämtliche Tatsachen informiert, sondern lediglich
darüber, dass überhaupt ein Erwerb stattgefunden hat, ist dies
für den strafbefreienden Rücktritt vom Versuch ausreichend.
Gleiches muss auch gelten, wenn das falsche Finanzamt infor-
miert wurde. Denn die Anforderungen an den Rücktritt dür-
fen nicht höher sein, als bei einer ordentlichen Anzeige.
Nach der ständigen Rechtsprechung ist für den Beginn der Ver-
suchsstrafbarkeit auf den Ablauf der Anzeigefrist abzustellen.
Denn ab diesem Zeitpunkt liegt es in der Hand der Finanzbe-
hörde, ob eine Steuererklärung angefordert wird oder nicht.
Die Versuchsstrafbarkeit endet, wenn das zuständige Finanz-
amt die Veranlagungsarbeiten üblicherweise abgeschlossen hat,
was nach Ansicht des BGH einen Monat nach Ablauf der
Anzeigefrist der Fall sein soll (BGH v. 25.07.2011 – 1 StR
631/10, NJW 2011, 3249). Denn dann sollen üblicherweise die
Veranlagungsarbeiten des Finanzamts abgeschlossen sein. Eine
bloße Versuchsstrafbarkeit – und damit auch ein Rücktritt vom
Versuch – ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.
– Jürgen E. Milatz – Matthias Wegmann –
PRAXISTIPPS
Soweit die Anzeige eines Erbfalls oder einer Schenkung nicht bereits durch einen Notar dem Finanzamt angezeigt wird, ist
es unbedingt erforderlich, den Erwerb selbst oder über einen Steuerberater anzuzeigen. Andernfalls droht die Strafbarkeit
wegen Steuerhinterziehung. Nach dem Ablauf der Anzeigefrist kann die Anzeige jedoch noch nachgeholt werden, solange das
Finanzamt sonst keine Kenntnis von dem Erwerb erhalten hat.
compact III-2015.indd 13 compact III-2015.indd 13 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
14
Überblick über die wesentlichsten Änderungen und Unterschiede zum Regierungsentwurf
Kontakt für weitere Infos:
StBin Britta Zelder
Tel +49 (0)40 36805-209
b.zelder@esche.de
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL
In der compact Ausgabe I/2015 haben wir Ihnen bereits die
wichtigsten geplanten Änderungen des am 07.01.2015 ver-
öffentlichten Gesetzesentwurfs vorgestellt. Nachdem das
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) am 18.06.2015
vom Bundestag und am 10.07.2015 vom Bundesrat
beschlossen wurde, trat das BilRUG nach Veröffentlichung
im Bundesgesetzblatt am 23.07.2015 in Kraft.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die
wesentlichsten Änderungen und Klarstellungen gegenüber
dem Gesetzesentwurf.
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz ist in Kraft getreten
Kontakt für weitere Infos:
WPin StBin Beatrix Arlitt
Tel +49 (0)40 36805-210
b.arlitt@esche.de
STEUERN AKTUELL
Werden Unternehmen durch einen Schuldenschnitt saniert,
ergeben sich hieraus häufi g steuerpfl ichtige Gewinne. Die
drohende Steuerbelastung kann die Sanierung vereiteln. In der
Praxis wird die Steuerbelastung letztlich häufi g auf Grundlage
von Billigkeitsmaßnahmen nach dem sogenannten Sanierungs-
erlass vermieden. Unsicherheiten bestehen weiterhin, ob es für
den Sanierungserlass eine hinreichende Rechtsgrundlage gibt.
Der 10. Senat des Bundesfi nanzhofs (BFH) hat das bejaht, die
Frage aber am 25.03.2015 dem großen Senat des BFH vor gelegt.
Was die drohende Gewerbesteuerbelastung angeht, so müs-
sen entsprechende Billigkeitsmaßnahmen in der Regel bei
den betroffenen Gemeinden erwirkt werden. Das erzeugt
Schwierigkeiten. Diese sind wohl auch nicht durch eine jün-
gere verfahrensrechtliche Änderung ausgeräumt worden
(§ 184 Abs. 2 S.1 Abgabenordnung).
Wegen der mit echten Schuldenschnitten verbundenen Pro-
bleme beschränken sich die Gesellschafter in Sanierungssitua-
tionen häufi g auf einen Rangrücktritt. Steuerlich wirkt dieser
allerdings wie ein Forderungsverzicht, wenn das Dar lehen
bloß aus künftigen Gewinnen und einem etwaigen Liquidations-
Sanierungssteuerrecht: Neue Entwicklungen bei
Schuldenschnitt und Rangrücktritt
Kontakt für weitere Infos:
RA StB Dr. Robert Kroschewski
Tel +49 (0)40 36805-143
r.kroschewski@esche.de
erlös zurückzuzahlen ist. Formuliert werden sollte, dass
„sämtliches freies Vermögen“ für die Rückzahlung der Darle-
hen zu verwenden ist. Auch die Bezugnahme auf den „Bilanz-
gewinn“ (der beispielsweise Erträge aus der Aufl ösung von
Kapitalrücklagen erfasst) ist jedenfalls nicht immer geeignet.
Falls der Rangrücktritt wie ein Forderungsverzicht wirkt, liegt
allerdings eine steuerneutrale Einlage vor, soweit die Forde-
rung werthaltig ist (BFH, Urteil vom 15.04.2015 – I R 44/14).
– Dr. Robert Kroschewski – Marc Nürnberger –
Kontakt für weitere Infos:
RA Marc Nürnberger
Tel +49 (0)40 36805-414
m.nuernberger@esche.de
compact III-2015.indd 14 compact III-2015.indd 14 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
15
1. Die neue und viel diskutierte Regelung des § 272 Abs. 5
Handelsgesetzbuch neue Fassung (HGB n. F.) zur Bildung
einer ausschüttungsgesperrten Rücklage für Beteili-
gungserträge, auf deren Zahlung noch kein Anspruch
besteht, wurde im endgültigen Gesetz um Regelungen
zum Aufl ösungszeitpunkt ergänzt. Danach ist die Rück-
lage aufzulösen, sobald der Beteiligungsertrag ausge-
schüttet oder ein Anspruch auf dessen Zahlung erwor-
ben wird. Praktisch bedeutet die Klarstellung, dass es zur
Entstehung eines Rechtsanspruches auf einen Beteili-
gungsertrag genügt, wenn die Kapitalgesellschaft den
Beteiligungsertrag so gut wie sicher vereinnahmen kann.
Damit wird – entgegen der bisherigen Vermutung – die
neue Regelung voraussichtlich keine bedeutsame Praxis-
relevanz für die phasengleiche Vereinnahmung von Betei-
ligungserträgen erlangen.
2. Die in § 264 Abs. 3 HGB n. F. eingeführte Voraussetzung
der Einstandspfl icht des Mutterunternehmens für die
Inanspruchnahme der Tochterunternehmen von Erleich-
terungen für die Erstellung, Prüfung und Offenlegung des
Jahresabschlusses wurde dahingehend präzisiert, dass die
erforderliche Einstandspfl icht alle bis zum Abschlussstich-
tag eingegan genen Verpfl ichtungen umfasst. Nach der
Begründung des Rechtsausschusses reicht zur Erfüllung
dieser Voraussetzung in der Regel eine gesetzliche Ver-
lustübernahme nach § 302 Aktiengesetz aus einem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag aus. Somit
ergibt sich grundsätzlich keine bedeutsame Änderung
zum alten Gesetzesstand.
3. Im Hinblick auf den Erstkonsolidierungszeitpunkt von
Tochtergesellschaften im Rahmen eines Konzernabschlus-
ses wurde § 301 HGB n. F. um Ausnahmen erweitert.
Demnach dürfen z. B. nach Wegfall einer Befreiung nach
§§ 291, 292 HGB die Wertansätze zum Erwerbszeitpunkt
angesetzt werden, und es muss nicht zwingend eine
Bewertung zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung
erfolgen.
Weitgehend unverändert blieben die im Folgenden zusam-
mengefassten wesentlichen Punkte:
1. Die Anhebung der Schwellenwerte für die handelsrecht-
lichen Größenklassen gemäß § 267 HGB auf die EU-weit
höchstzulässigen Größen bleibt unverändert. Die Schwel-
lenwerte für kleine Kapitalgesellschaften erhöhen sich hin-
sichtlich Bilanzsumme und Umsatzerlöse um 24 %, für mit-
telgroße Unternehmen um 4 %. Die neuen Schwellenwerte
dürfen erstmals für nach dem 31.12.2013 beginnende
Geschäftsjahre und müssen spätestens für nach dem
31.12.2015 beginnende Geschäftsjahre angewandt werden.
Bilanzsumme
in T €
Umsatz
in T €
Mitar-
beiter
Kleinstgesell-
schaften
< 350 < 700 < 10
Kleine
Gesell-
schaften
alt 350 – 4.840 700 – 9.680
> 10 – < 50
neu 350 – 6.000 700 – 12.000
Mittelgroße
Gesell-
schaften
alt 4.840 – 19.250 9.680 – 38.500
< 250
neu 6.000 – 20.000 12.000 – 40.000
Große
Gesell-
schaften
alt > 19.250 > 38.500
> 250
neu > 20.000 > 40.000
2. Auch die Neudefi nition der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1
HGB bleibt gegenüber dem Regierungsentwurf unverän-
dert. Künftig umfassen die Umsatzerlöse auch Erträge, die
außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen
und bisher unter den sonstigen betrieblichen Erträgen
erfasst wurden. Die Neudefi nition der Umsätze darf wahl-
weise bereits für nach dem 31.12.2013 beginnende
Geschäftsjahre und muss spätestens für nach dem
31.12.2015 beginnende Geschäftsjahre Anwendung fi nden.
3. Künftig ist ein Ausweis von außerordentlichen Erträgen
und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung
nicht mehr zulässig. Stattdessen sind im Anhang Angaben
zu Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher
Größenordnung oder Bedeutung zu machen.
4. Weiterhin enthält das BilRUG eine Typisierung der Nut-
zungsdauer auf 10 Jahre für entgeltlich erworbene
Geschäfts- oder Firmenwerte sowie für selbstgeschaffene
immaterielle Vermögenswerte, deren Nutzungsdauer
nicht verlässlich bestimmt werden kann.
5. Die bereits im Regierungsentwurf enthaltenen Änderun-
gen der Berichtspfl ichten im Anhang, z. B. die Verlagerung
von Angaben aus Bilanz und Lagebericht in den Anhang,
bleiben zum Regierungsentwurf unverändert.
compact III-2015.indd 15 compact III-2015.indd 15 24.08.15 13:5324.08.15 13:53

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU | COMPACT | AUSGABE III · 2015
16
¬ Abfallrecht ¬ Gesellschaftsrecht ¬ Patentrecht ¬ Vermögensnachfolge
¬ Arbeitsrecht ¬ Gewerblicher Rechtsschutz ¬ Unternehmensteuerrecht
¬ Datenschutz und IT-Recht ¬ Immobilienrecht ¬ Vergaberecht
6. Auch die ergänzten Offenlegungsvorschriften bleiben
gegenüber dem Regierungsentwurf unverändert. Insbe-
sondere reicht die Einreichung eines ungeprüften Jahres-
abschlusses und die spätere Veröffentlichung des Bestäti-
gungsvermerks zur Wahrung der Offenlegungsfrist nicht
mehr aus.
– Beatrix Arlitt – Britta Zelder –
HANDLUNGSBEDARF
Die geänderten Vorschriften durch das BilRUG sind grundsätzlich erst auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2015
beginnen. Lediglich die angehobenen Schwellenwerte und die Neudefi nition der Umsatzerlöse dürfen wahlweise frühzeitig
Anwendung fi nden für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2013 beginnen und deren Jahresabschlüsse noch offen sind.
Nicht nur bei einer frühzeitigen freiwilligen Anwendung der Neudefi nition der Umsätze und Schwellenwerte sollten Sie Ihre
Kontenpläne und Bilanzierungshandbücher an die Änderungen des BilRUGs anpassen sowie die Auswirkungen auf bestehende
Verträge, die umsatzabhängige Regelungen enthalten, prüfen. Dies können vor allem Kreditverträge mit vereinbarten Covenants
oder umsatzabhängige Mieten und andere Vergütungen (z. B. Tantiemen) sein.
IMPRESSUM
HERAUSGEBER ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Am Sandtorkai 44 | 20457 Hamburg
Tel +49 (0)40 36805-0
Fax +49 (0)40 36805-333
www.esche.de
V.I.S.D.P. Katrin Busch
Fax +49 (0)40 36805-333
k.busch@esche.de
REDAKTION Katrin Busch
FOTOGRAFIE Photo Dobers
RECHTLICHE HINWEISE
Die in compact enthaltenen Informationen haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen. Die Lektüre von compact ersetzt keine individuelle
Beratung, so dass wir für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder
die Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Herausgeber zulässig.
© September 2015
INTERN
Jetzt neu: esche.blog.de
Seit Juli 2015 ist der neue ESCHE blog online. Unsere Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschafts prüfer posten regelmäßig
Artikel zu aktuellen Themen z. B. aus den Bereichen
Unter blog.esche.de/rss können Sie sich über neu eingestellte Blogbeiträge informieren lassen.
In eigener Sache
blog.esche.de
Aktuelle Informationen aus Recht,
Steuern und Wirtschaftsprüfung
JETZT NEU
compact III-2015.indd 16 compact III-2015.indd 16 24.08.15 13:5324.08.15 13:53